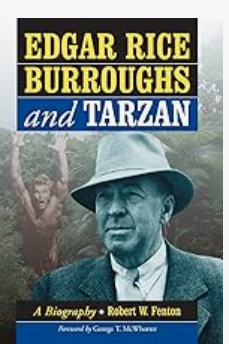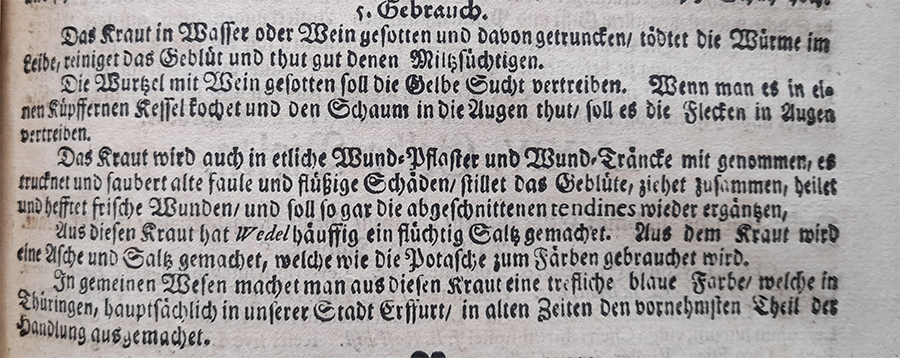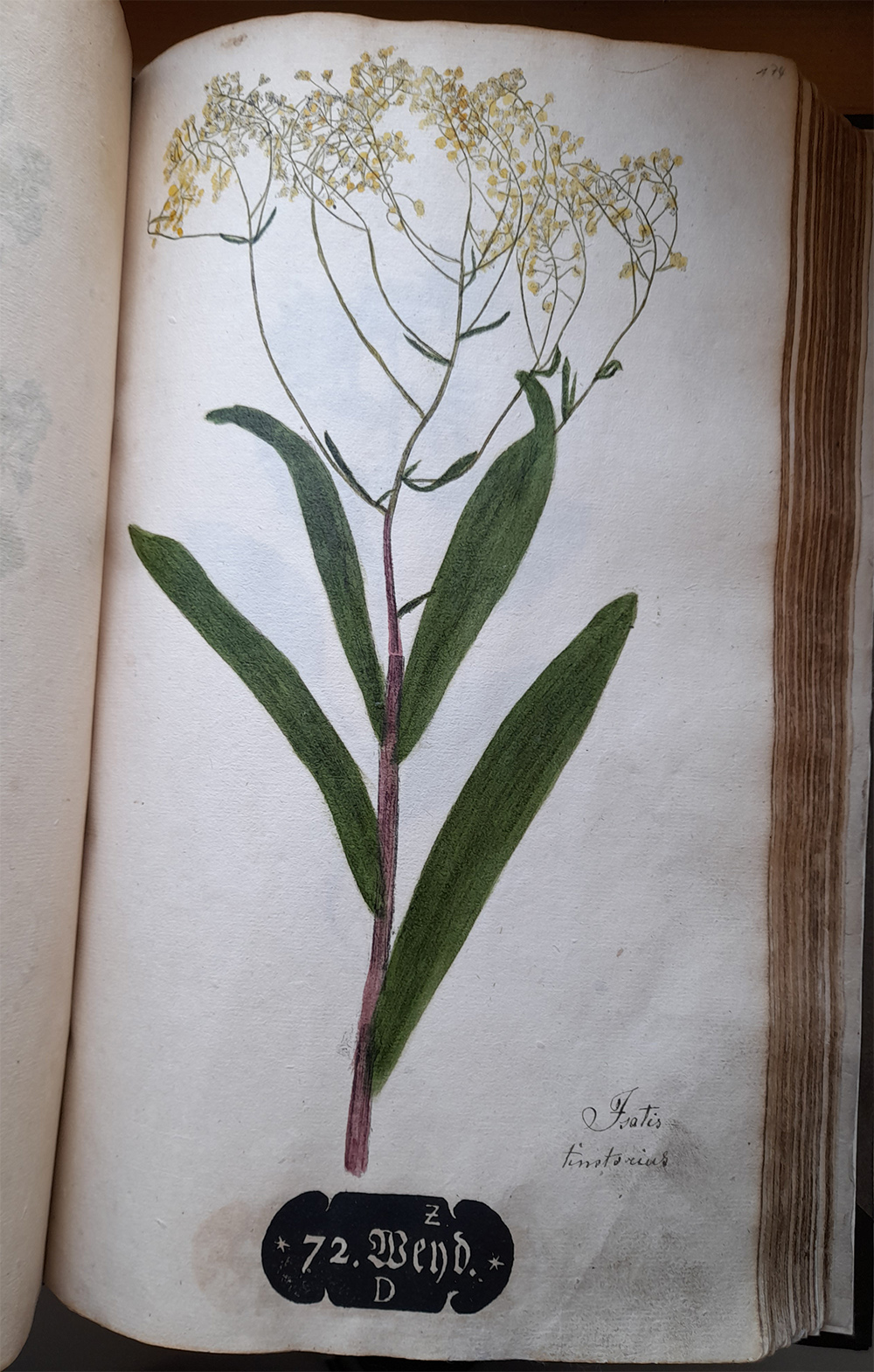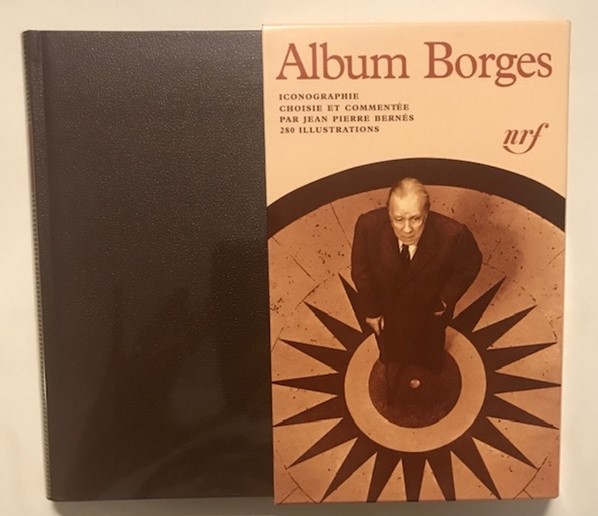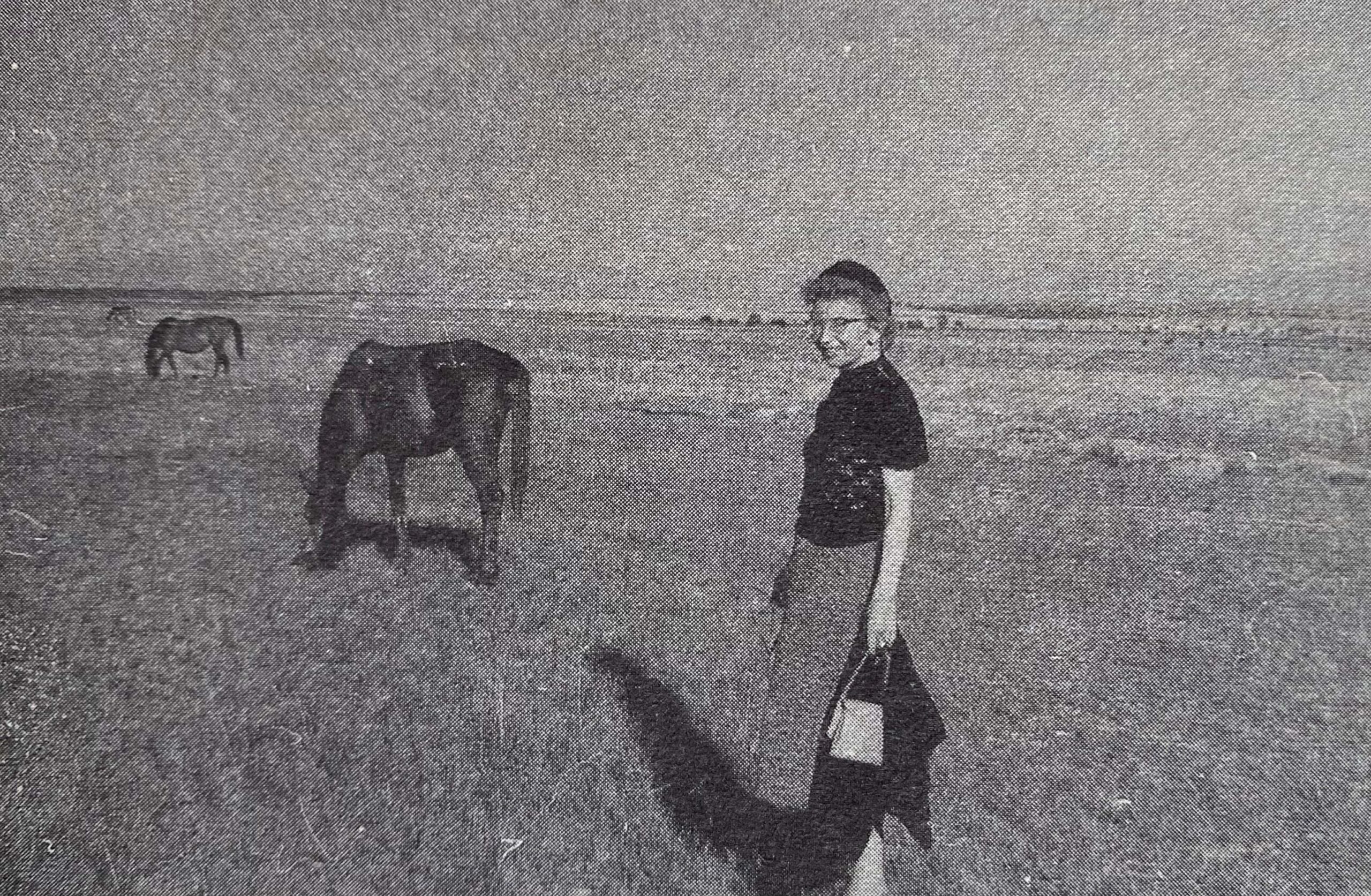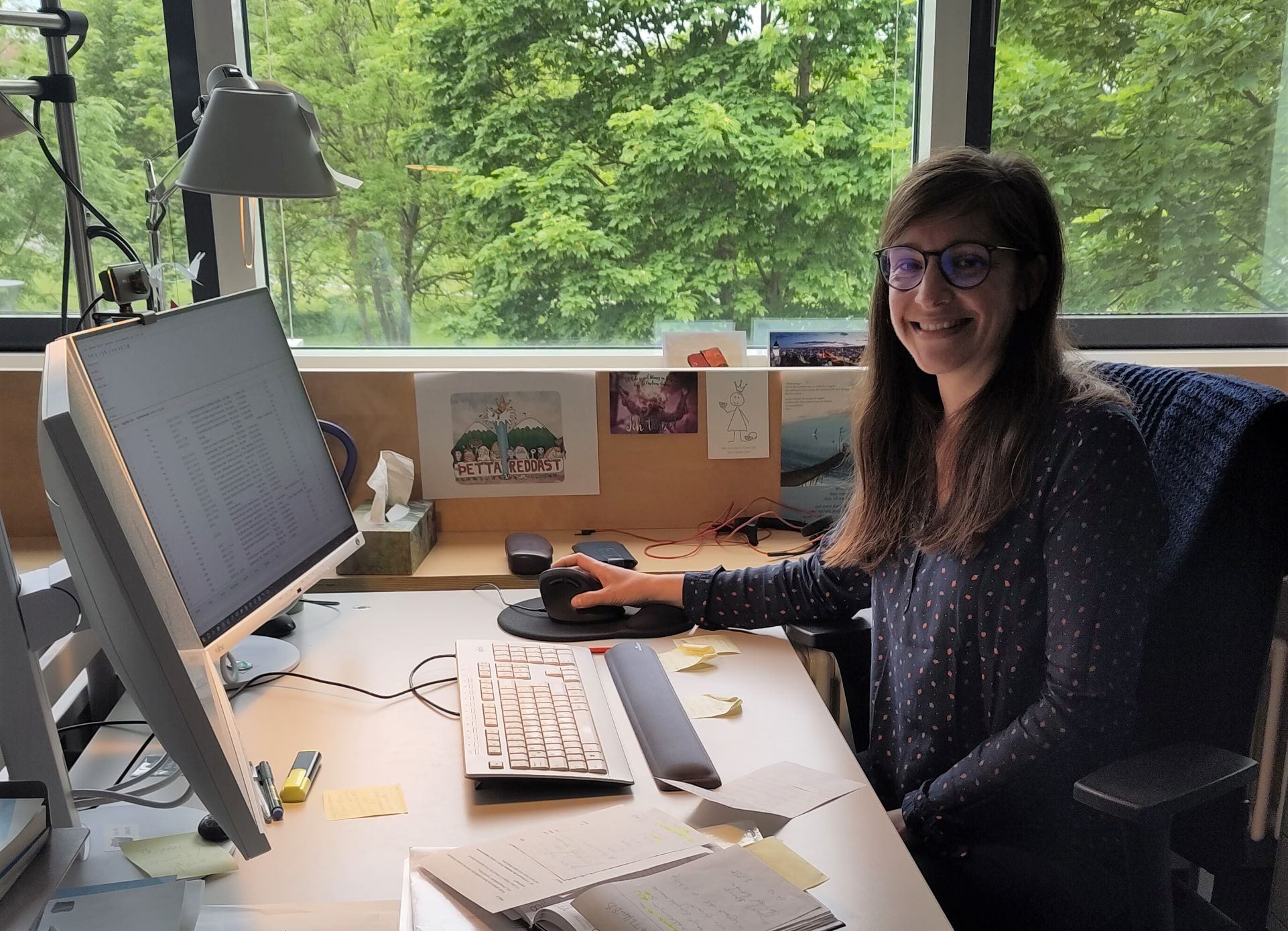In loser Folge stellen wir im „Lesezeichen“ Bibliotheks-Mitarbeiter*innen und deren Arbeitsbereiche vor, die normalerweise hinter den Kulissen verborgen bleiben – heute im Gespräch mit Martina Schlütter aus dem Team Hochschulbibliographie.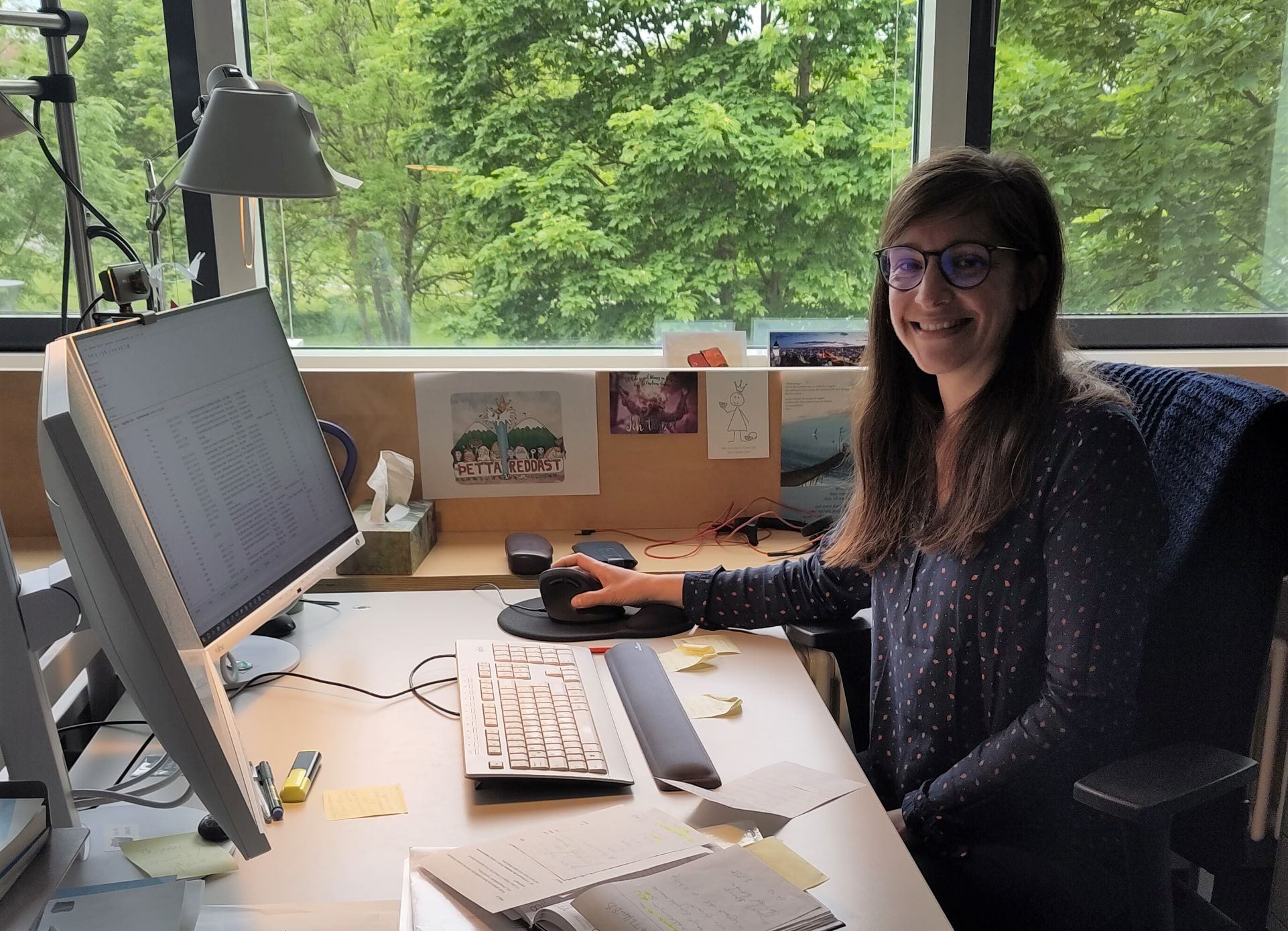
Was ist eigentlich eine Hochschulbibliographie?
Ein Dokumentationssystem für Publikationen einer Hochschule, hier also unserer Uni. Es dient der Erfassung, Präsentation und Dokumentation der Publikationsleistung aller Hochschulangehörigen und ist damit eine Art Schaufenster der Universität.
Welche Art von Publikationen findet man darin?
Früher waren es nur Monographien, Aufsätze und Rezensionen. Durch die fort-schreitende Entwicklung v.a. von digitalen Medien kommen neue Formen dazu, z.B. Blogbeiträge, Podcasts, Interviews und Poster.
Wo findet man die Hochschulbibliographie?
Sie ist als Suchsystem – ähnlich dem OPAC – in die Homepage der Bibliothek integriert.
Seit wann gibt es die Hochschulbibliographie und was ist für die Zukunft geplant?
In ihrer jetzigen Form gibt es sie seit 2007 und erfasst rückwirkend bis zum Jahr 1994 zur Zeit etwa 8000 Publikationen.
Im Lauf des nächsten Jahres wird die Hochschulbibliographie neu aufgestellt an den Start gehen. Im Hintergrund laufen thüringenweit die Vorbereitungen dazu. Das Projekt befindet sich aktuell in der Testphase. Bei uns in der UB gehören außer mir noch Manuela Dremel, Dr. Thomas Schneider und Luise Wenzel zum Projektteam.
Was verbirgt sich dahinter?
Das Publikationsmanagementsystem „Thüringer Universitätsbibliographie“ des Kooperationsverbundes der Thüringer Hochschulbibliotheken wird vom Land Thüringen im Rahmen der Thüringer Digitalisierungsstrategie gefördert. Gegenüber den bisher vor Ort erstellten Bibliographien bietet dieses System neue Möglich-keiten. Es dient u.a. dazu das Publikationsaufkommen der Wissenschaftler*innen landesweit quantitativ zu erfassen und das Open-Access-Monitoring zu erleichtern. Für Autoren wird es möglich sein, sich eigene Publikationslisten erstellen zu lassen.
Woher bekommen Sie die Informationen zu den Publikationen?
Da gibt es verschiedene Wege. Alle Hochschulangehörigen sind aufgerufen, uns ihre Veröffentlichungen zu melden. Das geht ganz einfach durch eine E-Mail an hochschulbibliographie.ub@uni-erfurt.de. Andere Publikationen „entdecken“ wir bei unserer täglichen Arbeit, wenn wir Medien erwerben und katalogisieren oder geförderte Open-Access-Veröffentlichungen bearbeiten. Sobald die neue Thüringer Universitätsbibliographie an den Start gegangen ist, können Autoren ihre Titel direkt über die Seite der neuen Universitätsbibliographie einreichen. Auch wird es dann möglich sein, Daten über automatische Importe aus externen Datenquellen in die Datenbank einzufügen.
Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Es sollte selbstverständlich werden, dass die Publizierenden ihre Veröffentlichungen an die Hochschul-/Universitätsbibliographie melden. Da ist im Moment noch Luft nach oben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Marion Herzberg