 Das Demonstrativpronomen 'is, ea, id'
Das Demonstrativpronomen 'is, ea, id'
 Das Demonstrativpronomen 'ipse, ipsa, ipsum'
Das Demonstrativpronomen 'ipse, ipsa, ipsum'
 Fehlendes Demonstrativpronomen
Fehlendes Demonstrativpronomen
 Das Possessivpronomen 'suus, sua, suum'
Das Possessivpronomen 'suus, sua, suum'
 Das Demonstrativpronomen 'is, ea, id'
Das Demonstrativpronomen 'is, ea, id'
 Das Demonstrativpronomen 'ipse, ipsa, ipsum'
Das Demonstrativpronomen 'ipse, ipsa, ipsum'
 Fehlendes Demonstrativpronomen
Fehlendes Demonstrativpronomen
 Das Possessivpronomen 'suus, sua, suum'
Das Possessivpronomen 'suus, sua, suum'
Formenbildung:
| Kasus | Singular | Plural | ||||
| m | f | n | m | f | n | |
| Nom. | is | ea | id | iî | eae | ea |
| Gen. | eius | eius | eius | eôrum | eârum | eôrum |
| Dat. | eî | eî | eî | iîs / eîs | iîs / eîs | iîs / eîs |
| Akk. | eum | eam | id | eôs | eâs | ea |
| Abl. | eô | eâ | eô | iîs / eîs | iîs / eîs | iîs / eîs |
Verwendung im Satz:
|
Entsprechend dem deutschen 'dieser, diese, dieses' verweist 'is, ea, id' auf etwas bereits Erwähntes zurück (anaphorischer Gebrauch):
|
Als das schwächste der lateinischen Demonstrativpronomina kann substantivisch gebrauchtes 'is, ea, id' in allen Kasus außer dem Nominativ dem deutschen Personalpronomen 'er, sie, es' entsprechen:
|
Im Genitiv ersetzt 'is, ea, id' das Possessivpronomen der 3. Person im nicht reflexiven Fall. Es bedeutet dann:
| eius |
dessen, sein (mask. u. neutr. Sg.) deren, ihr (fem. Sg.) |
|
eôrum eârum |
deren, ihr (mask. fem. u. neutr. Pl.) |
Anwendungsbeispiele:
|
Wenn sich auf eine Form von 'is, ea, id' ein Relativpronomen bezieht, bedeutet es 'derjenige, diejenige, dasjenige' bzw. 'der, die, das' oder 'einer, eine, eines':
|
Bisweilen weist 'is, ea, id' auch auf einen mit 'ut' eingeleiteten Konsekutivsatz voraus. Oft empfiehlt sich dann eine Übersetzung mit 'so'.
|

Das Demonstrativpronomen 'ipse, ipsa, ipsum'
Anders als das deutsche 'selbst' wird das lateinische Demonstrativpronomen 'ipse, ipsa, ipsum' dekliniert:
| Kasus | Singular | Plural | ||||
| m | f | n | m | f | n | |
| Nom. | ipse | ipsa | ipsum | ipsî | ipsae | ipsa |
| Gen. | ipsîus | ipsîus | ipsîus | ipsôrum | ipsârum | ipsôrum |
| Dat. | ipsî | ipsî | ipsî | ipsîs | ipsîs | ipsîs |
| Akk. | ipsum | ipsam | ipsum | ipsôs | ipsâs | ipsa |
| Abl. | ipsô | ipsâ | ipsô | ipsîs | ipsîs | ipsîs |
Wie das Deutsche 'selbst', 'persönlich' dient es der Hervorhebung einer Person oder eines Gegenstandes gegenüber einem anderen.
|
Im ersten Satz liegt die Betonung auf Labienus, der auf dem Kontinent zurückbleibt. Im zweiten richtet sich der Blick auf Cäsars eigene Aktion.
Im Genitiv steht es dabei häufig statt des reflexiven Possessivpronomens der 3. Person 'suus, sua, suum' und bedeutet dann 'sein, ihr eigen'. Vgl.:
|

Fehlendes Demonstrativpronomen im Lateinischen
Anders als im Deutschen steht im Lateinischen kein Demonstrativpronomen, wenn ein Substantiv durch von 'alter ... alter' – 'der eine ... der andere' in zwei Gruppen aufgeteilt wird.
|

Das Possessivpronomen 'suus, sua, suum' – 'sein, ihr'
In den beiden lateinischen Beispielsätzen richtet sich die Form "suum" allein nach dem Beziehungswort "equum". In der deutschen Übersetzung stimmen die Possessivpronomina "sein" bzw. "ihr" zwar im Numerus und Kasus mit dem Beziehungswort "Pferd" überein, das Genus richtet sich jedoch nach dem des Besitzers.
Ohne Kenntnis der Situation wird im Deutschen nicht eindeutig klar, ob Paula ihre eigene oder Aemilias Mutter besucht. Je nach Kontext hieße der Satz daher in der lateinischen Übersetzung:
In vielen Fällen empfiehlt es sich, in der deutschen Übersetzung ein "sein" oder "ihr" hinzuzufügen, wenn der Kontext dies nahelegt, z.B:
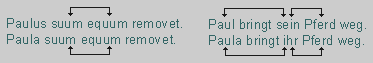
Paula Aemiliam matremque suam visitat.
Paula besucht Aemilia und ihre (eigene) Mutter.
Paula Aemiliam matremque eius visitat.
Paula besucht Aemilia und ihre (= deren) Mutter.
Lateinisch steht "suus, sua, suum" nur dann, wenn das Eigentumsverhältnis betont werden oder ein Gegensatz zum Ausdruck gebracht werden soll.
Daraus ergibt sich für die Übersetzung folgendes:
Wenn "suus, sua, suum" steht, bedeutet es zumeist "sein eigen, ihr eigen", z.B.:
Labiênus suum equum removet.
Labienus bringt sein eigenes Pferd weg.
Paulus matrem visitat.
Paul besucht seine Mutter.
Labiênus equum removet.
Labienus bringt sein Pferd weg.
